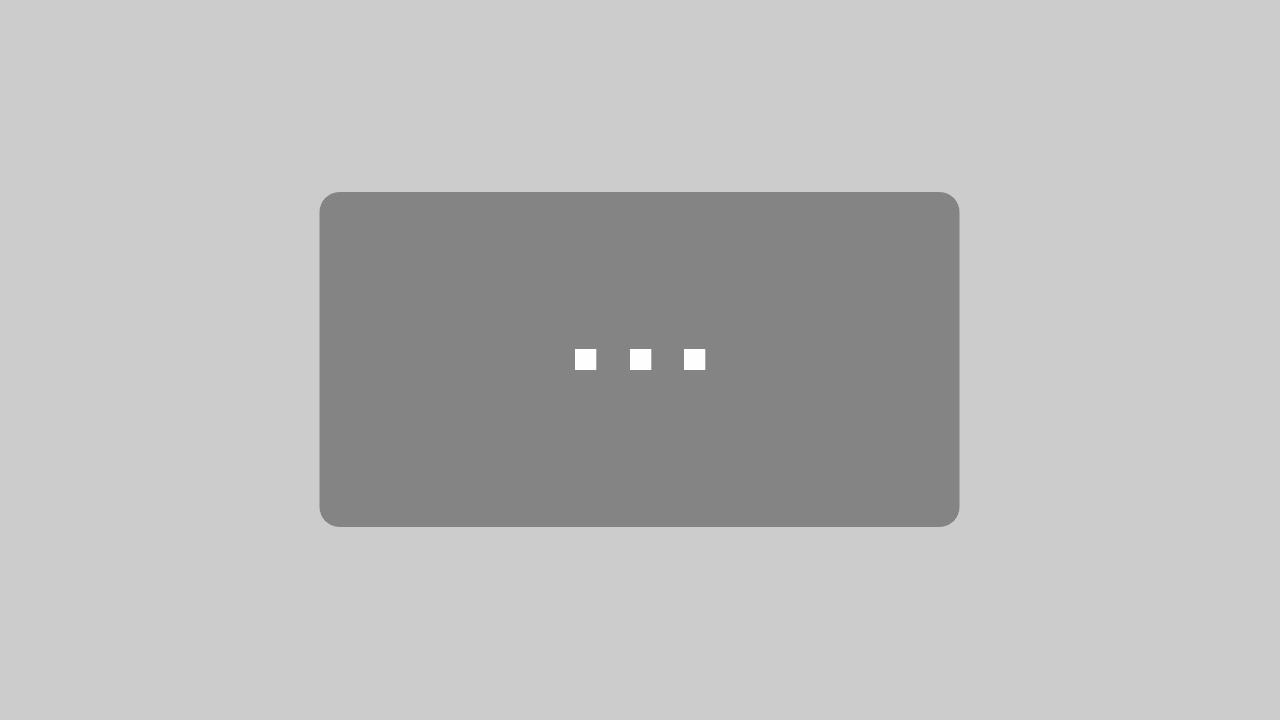Luis Berra
A PIANO WON’T FIX YOUR TORMENTED SOUL
Es gibt Alben, die entstehen nicht unter dem Scheinwerferlicht, sondern im Schatten der Sehnsucht. „A PIANO WON’T FIX YOUR TORMENTED SOUL“ ist genau ein solches Werk – eine Sammlung von musikalischen Skizzen, die nicht den Anspruch erheben, zu heilen, sondern zu zeigen: So klingen die Risse in einer verletzlichen Seele.
Luis Berra, geboren in Nicaragua, geprägt von einer Kindheit und Jugend zwischen toskanischen Olivenhainen, argentinischem Temperament und italienischer Sinnlichkeit, hat mit diesem Album einen künstlerischen Raum geschaffen, in dem Zwischentöne und Zerbrechlichkeit regieren. Nach Jahren der Wanderschaft, Studien und des Suchens – vom Konservatorium in Sardinien, über die Jazz-Bars Colorados, bis hin zum Rückzug in den Bayerischen Wald – verdichtet sich in seiner Musik die Erfahrung eines Lebens, das an den Rändern gebaut ist. Jedes Stück, das Luis Berra schreibt, trägt Spuren von Staub, Kindheitsgeruch, den Schatten der Eltern, das Lächeln seiner Tochter.
Berra ist ein zutiefst eigenständiger Künstler: Klassisch geprägt, improvisierend denkend, nie kalkuliert, immer einladend zum ehrlichen Fühlen. Seine Musik ist beeinflusst von der Melancholie südamerikanischer Melodik, der Wehmut italienischer Dichtung und der Aufrichtigkeit des frühen Blues. Über 70 Millionen Streams weltweit und zahlreiche Auftritte in renommierten Sälen zeugen von einer Jetzt-Zeit, in der leise Stimmen oft am stärksten sind.
Im Zentrum des Albums aber steht ein Gedicht – geschrieben vom Komponisten selbst, es teilt mit dem Albumtitel die Erkenntnis: Ein Klavier, so sehr wir es auch berühren, heilt keine gequälte Seele. Es gibt keine Duftkerzenmusik, keine tröstenden Harmonien am gedeckten Tisch der Existenz. Die im Booklet abgedruckten Zeilen entstehen aus der Betrachtung des Alltags: Da sind die sich windenden Olivenbäume, die trunkenen Fliegen, das nächtliche Wachbleiben der Tochter. Da ist der Wolf, verletzlich und hungrig, und da sind wir selbst, erschöpft von endlosen Ritualen der Schuld und der Wiederholung.
Die Musik auf diesem Album ist eine Antwort auf dieses Gedicht – manchmal trotzig schwach, wie die erwähnten Knochen eines Rotkehlchens, dann wieder roh und ehrlich, so fragil wie Kinderreime in einem Provinzkindergarten. Kein Wohlklang, der betäuben will. Sondern Musik als ein Feld, auf dem wir barfuß laufen: verletztlich, echt, zuweilen ruhelos – und doch voller Hoffnung auf Verwandlung. Wie das Gedicht, das von der Unmöglichkeit des Trostes singt, fängt Berras Musik den Zwischenraum ein, in dem sich Trauer und Freude, Verzweiflung und Liebe streifen.
Man hört das Echo alter Häuser, die Kälte der Novemberwälder, das Kichern der Tochter, das Schweigen der geliebten Mutter – und die Stille, die jeder Verlust in uns hinterlässt. Musik und Poesie verweben sich so zu einem Porträt eines Menschen, der weiß: Es geht nicht ums Ankommen, nicht ums Beneiden. Es geht darum, zu bleiben – bei sich, in den eigenen Wunden, mit offenem Ohr für das, was daneben liegt.